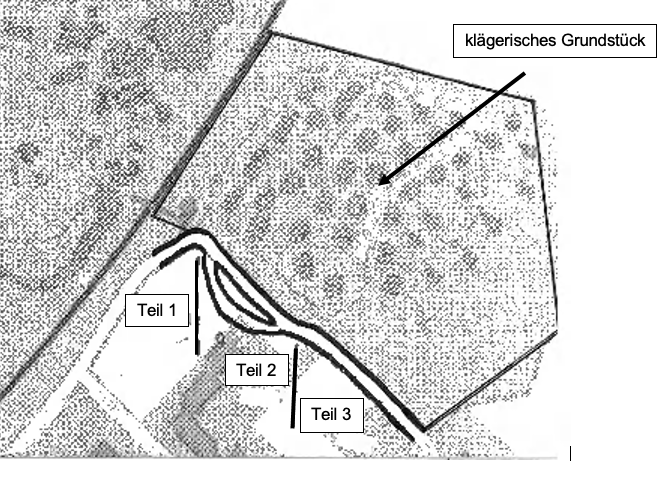Die – mit deutlichem Ruckeln – begonnene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus bildet nach Auffassung der Wissenschaft den entscheidenden Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. Politisch zunächst in den Vordergrund gerückt war die Frage nach der Einführung einer Impfpflicht, allgemein oder für bestimmte Berufsgruppen. Gleichsam am anderen Ende der Diskussion steht die Frage, ob es einen Anspruch auf vorgezogene Impfung geben kann, also eine Impfung abweichend von der in der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV 2 (CoronaImfpV) vom 18. Dezember 2020 festgelegten Reihenfolge.
Als eines der ersten Gerichte hatte sich das Sozialgericht Oldenburg mit dieser Frage zu befassen (Beschl. vom 21. Januar 2021 – S 10 1/21 ER –). Das Gericht hatte die Frage zu entscheiden, ob aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls jemand, der nicht in die Kategorie der Schutzimpfungen mit höchster Priorität nach § 2 CoronaImpfV, sondern in die Priorität nach § 3 CoronaImpfV fiel, einen Anspruch auf vorgezogene Schutzimpfung hat. Das Gericht verneinte diese Frage.
Zum einen sehe die Verordnung ein Abweichen von der Priorisierung, wie sie die Verordnung mit den unterschiedlichen Gruppen in §§ 2 bis 4 CoronaImpfV normiere, nicht vor. Die Entscheidung des Sozialgerichts verhält sich allerdings in diesem Zusammenhang nicht dazu, dass die Priorisierungsregelung in § 1 Abs. 2 CoronaImpfV als Soll-Vorschrift ausgestaltet ist. Zum anderen könne in dem vom Gericht zu entscheidenden Fall ein Anspruch auch nicht unmittelbar aus Verfassungsrecht abgeleitet werden. Schließlich mangele es auch an der Darlegung eines Anordnungsgrundes, da nicht glaubhaft gemacht sei, dass für den Antragsteller die strikte Einhaltung der für die gesamte Bevölkerung dienenden Hygieneregeln unzumutbar sei und einen hinreichenden Schutz biete. Die Entscheidung des Sozialgerichts würdigt die prinzipielle Schutzbedürftigkeit des Antragstellers ebenso wie das Dilemma für staatliche Stellen, eine zeitliche und sachliche Priorisierungsentscheidung treffen zu müssen, weil die im Augenblick zur Verfügung stehenden Impfdosen nicht ausreichen, um alle Impfwilligen unverzüglich zu impfen.
Das letzte Wort wird die Entscheidung nicht gewesen sein. Die Fragen, die die CoronaimpfV aufwirft sind ebenso vielfältig wie die Fallgestaltungen, anhand derer sich die Verordnung bewähren muss. Bis ausreichend Impfstoff für alle Impfwilligen zur Verfügung steht, werden sich weitere Gerichte mit Fragen befassen müssen, ob und ggf. wann ausnahmsweise ein Anspruch auf vorgezogene Impfung besteht.