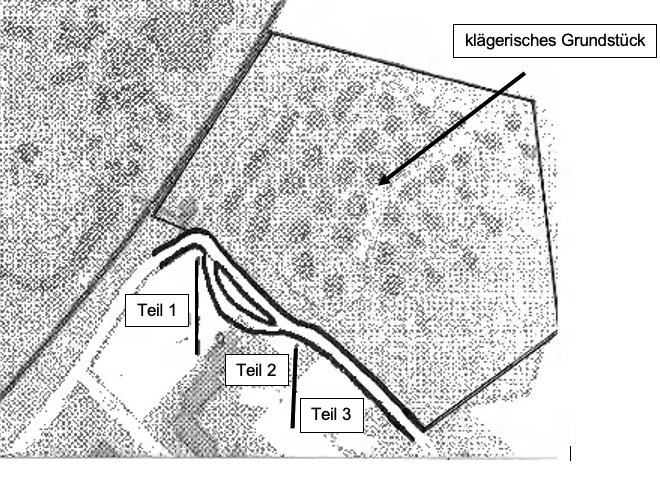Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat sich in einem Urteil vom 4. Februar 2020 (10 S 1082/19) zur grundsätzlichen Frage geäußert, welche Rechtschutzmöglichkeiten Gemeinden gegen Beanstandungen des Landesdatenschutzbeauftragten haben.
Die klagende Gemeinde sah sich in den Jahres 2016 bis 2018 mit insgesamt 177 Anträgen ein und desselben Antragstellers auf Akteneinsicht konfrontiert. Um die Flut von Anträgen zu bewältigen hatte die Gemeinde eine Beamtin im gehobenen Dienst eingestellt und sich ergänzende Hilfe eines Anwaltsbüros bedient. Da die Gemeinde einen erheblichen Teil der Anträge für offensichtlich rechtsmissbräuchlich hielt, ließ sie diese allerdings gänzlich unbeantwortet. Der Antragsteller wandte sich daraufhin an den Landesdatenschutzbeauftragten, der schließlich eine Beanstandung gegenüber der Gemeinde aussprach. Gegen diese Beanstandung erhob die Gemeinde Klage.
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg sah die Klage – anders als das Gericht I. Instanz – als zulässig an. Die Klagebefugnis leite sich aus dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde ab, das durch die Beanstandung des Landesdatenschutzbeauftragten beeinträchtigt sein könne. Zulässige Klageart sei die Feststellungsklage, da nach der landesrechtlichen Ausgestaltung in Baden-Württemberg die Beanstandung des Landesdatenschutzbeauftragten eine bloße behördliche Wissenserklärung und nicht einen feststellenden Verwaltungsakt darstelle.
In der Sache wies der Verwaltungsgerichtshof die Klage allerdings zurück. Das durch den Antrag auf Akteneinsicht eingeleitete Verwaltungsverfahren müsse durch eine Entscheidung der Gemeinde beendet werden, behördliche Untätigkeit sei keine gesetzlich zulässige Verfahrensweise.
Die Entscheidungsgründe enthalten allerdings auch etwas Trost für die geplagte Gemeinde. Denn der Verwaltungsgerichtshof weist in einem obiter dictum darauf hin, vieles dafür spreche, dass die Akteneinsichtsgesuche rechtsmissbräuchlich waren. So lagen konkrete Anhaltspunkt vor, dass die Anträge nicht zum Zwecke der Informationserlangung gestellt wurden, sondern dem Ziel dienten, die Verwaltung zu lähmen bzw. Verfahren zu verschleppen und damit der Behördenblockierung dienten (behördenbezogener Missbrauch). Auch sah das Gericht deutliche Indizien für die sinnwidrige Instrumentalisierung des Informationsanspruchs zur Verfolgung verfahrensfremder bzw. -widriger Zwecke, insbesondere zur Generierung von Honoraransprüchen des Bevollmächtigten des Antragstellers (verwendungsbezogener Missbrauch). Schlussfolgerung: Die Akteneinsichtsanträge durften zwar nicht unbeantwortet bleiben, sie hätten aber als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen werden können.
Die Missbrauchskriterien dürften auch bei Auskunftsbegehren zu prüfen sein, die durch Rechtsvorschriften begründet werden, die den Versagungsgrund der missbräuchlichen Antragstellung – wie ihn § 9 Abs. 3 Nr. 1 IFG B-W regelt- nicht ausdrücklich normieren. Denn letztlich steht dahinter der allgemeine Rechtsgedanke von Treu und Glauben (vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, Urt. vom 12. Juli 2018 – 12 B 8/17).






 -->
-->